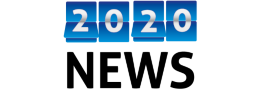Ein Beitrag von Viviane Fischer
ES GEHT LOS!!! Das Archiv vom Corona-Ausschuss wird nun Sitzung für Sitzung veröffentlicht, mit allen Links, Studien und Dokumenten. Es ist ein bedeutsamer Teil der Zeitgeschichte. Mit seiner Sammlung von inzwischen über 700 Experten- und Zeugengesprächen ist es nach unserem Kenntnisstand weltweit einzigartig. Das Archiv belegt unzweifelhaft, was wann bekannt war und was damit auch Entscheidungsträger hätten wissen können. Wir bitten die Leser, die Zusammenfassung auf 2020News ebenso wie das jeweils im Archiv unter www.corona-ausschuss.org verlinkte Transkript mit allen in Bezug genommenen Links und Belegen herunterzuladen und idealerweise auch in ausgedruckter Form zu verwahren, damit die wichtigen Informationen nicht einem möglichen digitalen Memory-Hole zum Opfer fallen können (George Orwell lässt grüßen). Das Corona-Archiv sollte in mindestens 100.000 Haushalten weltweit gesichert werden. Wir veröffentlichen im Wechsel historische und aktuelle Sitzungen im Transkript. Es würde uns die schweisstreibende Arbeit sehr erleichtern, wenn uns jeder, der es finanziell einrichten kann, mit einer Spende von € 1 pro Sitzung unterstützen würde: Stiftung Corona-Ausschuss IBAN DE23 8105 0555 0101 0376 78 oder per PayPal. Wir können Spendenbescheinigungen ausstellen. 1000 Dank!
Es folgt die Zusammenfassung des Transkriptes der ersten Sitzung vom Corona-Ausschuss vom 14.07.2020 „Lernen vom Untersuchungsausschuss Schweinegerippe“ mit dem Gesprächspartner Dr. Wolfgang Wodarg. Fragen stellten bzw. Wortbeiträge lieferten die Rechtsanwälte Viviane Fischer, Dr. Reiner Fuellmich, Antonia Fischer und Dr. Justus Hoffmann.
Eine Anmerkung: Die Bedeutung des Engagements von Dr. Wolfgang Wodarg für den gelungenen Start vom Corona-Ausschuss in den Themenkomplex und für unser weiteres Wirken kann aus meiner Sicht gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Nur durch sein umfangreiches Erfahrungswissen war es möglich, dass wir vier Rechtsanwälte sofort viele Antworten auf die drängendsten Fragen aus Medizin, Wissenschaft und Politik erhielten und hinsichtlich unserer weiteren investigativen Tätigkeit die richtigen Fährten aufnehmen konnten. Mein großer Dank an dieser Stelle geht daher an den langjährigen wissenschaftlichen und medizinischen Berater vom Corona-Ausschuss Dr. Wolfgang Wodarg!
Das überarbeitete Transkript der 1. Sitzung (82 Din A4-Seiten) ist gründlich Korrektur gelesen worden. Es ist bewußt nur marginal geglättet, so dass es als Dokumentation des tatsächlich Gesagten dienen kann. Es enthält in Bezug genommene Studien und Dokumente, so dass der geneigte Leser sich selbst ein Bild von der Erkenntnislage machen kann. Die Nachweise sind zur Vermeidung von Doppelungen bei der Sicherung der Sitzung nicht erneut im nachfolgenden zusammenfassenden Text verlinkt.
Sitzung 1 vom Corona-Ausschuss: „Lernen vom Untersuchungsausschuss Schweinegrippe“, die Zusammenfassung
1. Einleitung
Am ersten Sitzungstag des Corona-Ausschusses steht die Reflexion der Schweinegrippe von 2009 im Zentrum. Viviane Fischer führt in die Thematik ein und erläutert, dass sich der Ausschuss mit der „Gesamtproblematik Virus und Maßnahmen und Folgen“ befassen werde. Als erster Gast ist Dr. Wolfgang Wodarg eingeladen, der als Arzt für öffentliches Gesundheitswesen, Internist und Bundestagsabgeordneter den Schweinegrippen-Untersuchungsausschuss des Europarats mitgestaltet hat. Ziel ist es auch, aufzuklären, welche Mechanismen zur Pandemieausrufung führen können und welche wirtschaftlichen und politischen Interessen involviert sind. Fischer betont, dass es der Themenplan des Ausschusses flexibel gehalten werde, um neue Entwicklungen zu integrieren.
Wodarg beginnt mit einem Rückblick auf seine beruflichen Stationen. Er berichtet, wie er als Amtsarzt ein eigenes Sentinel-System zur Grippeüberwachung etabliert hat: „Ich habe mir ein Instrument gebaut… jeden Montag von Oktober bis März wurde in Krankenhäusern und Praxen abgefragt, wie viele fehlen.“ Dieses Instrument diente nicht nur zur Analyse von Epidemien, sondern auch als Grundlage für Handlungsempfehlungen für Behörden. Wodarg betont, dass man nie auf die Idee gekommen sei, bei Grippewellen Masken zu tragen: „Influenza wird ja genauso übertragen wie Corona-Viren… aber da ist nie einer auf die Idee gekommen, diese Binden zu tragen.“
Das Auftreten der Schweinegrippe im Jahr 2009 ist für Wodarg Ausdruck einer Reihe bedenklicher Entwicklungen, insbesondere die Rolle der WHO und der Impfstoffindustrie. Die Sitzung soll aufzeigen, wie sich Definitionen, Institutionen und wissenschaftliche Aussagen veränderten, um Maßnahmen zu rechtfertigen. Der Vergleich mit der COVID-19-Pandemie steht implizit im Raum, wird aber im weiteren Verlauf noch explizit gezogen. Das Fundament für die Sitzung ist damit gelegt: historische Analyse als Basis für Gegenwartsdiagnostik.
2. Hintergrund: Schweinegrippe und Pandemie-Definition
Die Schweinegrippe, ausgelöst durch das H1N1-Virus, wurde 2009 zur weltweiten Pandemie erklärt. Dr. Wodarg war zu dieser Zeit Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Gesundheitsausschusses. Als erfahrener Amtsarzt beobachtete er die Vorgänge mit großer Skepsis. Besonders stutzig machte ihn der alarmistische Ton der WHO und einiger Medien bei vergleichsweise geringer Fallzahl: „Da sind es dann ja nachher mal gerade 15.000 gewesen. Also das ist deutlich weniger als bei anderen Grippen gewesen.“
Ein zentraler Kritikpunkt ist die Veränderung der Pandemie-Definition durch die WHO. Vor der Änderung wurde eine Pandemie als weltweite Verbreitung einer neuen Krankheit mit einer „enormen Zahl von schweren Erkrankungen und Todesfällen“ definiert. Dieser Zusatz wurde jedoch 2009 kurz vor Ausrufung der Schweinegrippe gestrichen. Damit konnte jede weit verbreitete Virusinfektion als Pandemie gelten, unabhängig von ihrer Schwere.
Wodarg sieht hierin ein strategisches Manöver, um politische und wirtschaftliche Interessen zu bedienen. Besonders Neil Ferguson vom Imperial College London, der bereits für ähnliche Vorhersagen bei der Maul- und Klauenseuche bekannt war, wird als zentraler Akteur genannt. Ferguson hatte für die WHO Modelle entwickelt, die auf Basis von Flugbewegungen ein weltweites Ausbreitungsszenario entwarfen. Ein völlig unseriöser Ansatz, wie sich später zeigte.
Die Rolle der Medien trug laut Wodarg ebenfalls entscheidend zur Eskalation bei. Bilder von toten Vögeln und überfüllten mexikanischen Krankenhäusern erzeugten Angst. Wodarg spricht hier von einem „Agenda-Setting“, also einer bewussten Steuerung der öffentlichen Wahrnehmung. Die Firma Veratect habe systematisch Fälle gesammelt und verbreitet, um Druck auf Behörden wie das CDC in den USA auszuüben.
Am Ende dieser Kette steht die Ausrufung der Pandemie durch die WHO. Diese Entscheidung hatte weitreichende Konsequenzen, da zahlreiche Verträge mit Impfstoffherstellern automatisch in Kraft traten. Wodarg erkennt hierin den Beginn eines Paradigmenwechsels: Weg von medizinisch-epidemiologischen Kriterien hin zu politisch-wirtschaftlich motivierten Entscheidungen. Der Boden für weitreichende Maßnahmen war bereitet.
3. Die Rolle der WHO und internationale Verträge
Ein zentraler Punkt in Wodargs Analyse ist die Rolle der Weltgesundheitsorganisation. Laut ihm war die WHO schon 2009 nicht mehr allein wissenschaftlich orientiert, sondern in ein komplexes Geflecht wirtschaftlicher und politischer Interessen verstrickt. Das zeigte sich besonders deutlich in der Art und Weise, wie die Pandemieausrufungen als Auslöser für internationale Verträge fungierten. Die Definitionshoheit lag dabei – ebenso wie heute – in der Hand der WHO: „Die Pandemie wird definiert durch die WHO. Das war festgelegt im Vertrag.“ Sobald die WHO Stufe 6 ausrief, griffen automatisch Verträge mit Impfstoffherstsellern. Die Kritik, dass die WHO dadurch zum Werkzeug wirtschaftlicher Interessen wurde, zieht sich wie ein roter Faden durch Wodargs Aussagen. Ein zentraler Punkt bleibt: Der Verlust unabhängiger wissenschaftlicher Bewertung zugunsten externer Einflussnahme.
Wodarg beschreibt detailliert die Verträge zwischen Staaten und Impfstoffherstellern wie GlaxoSmithKline und Novartis. Diese beinhalteten Abnahmeverpflichtungen, sobald die WHO eine Pandemie erklärte. Besonders brisant: „Diese Verträge waren geheim.“ Erst durch Leaks wurden Inhalte bekannt. In den Verträgen war etwa geregelt, dass Impfstoffe in Großpackungen geliefert und durch die Staaten selbst verteilt werden sollten. Auch Produktionszuschüsse wurden gewährt: „Deutschland hat den beiden großen Firmen, soweit ich weiß, 10 Millionen Zuschuss gegeben.“
Als die Filmemacherin Lilian Franck im Rahmen des in der Sitzung gezeigten Ausschnitts aus ihrem Film Trust WHO einen WHO-Sprecher direkt mit den Geheimverträgen zwischen Pharmaunternehmen und Regierungen konfrontiert, entgegnet dieser: „Natürlich muss man darüber, sowie über alles andere Bescheid wissen. Hinterher ist es leicht zu sagen, derjenige hätte dies nicht machen sollen und ein anderer hätte jenes nicht machen sollen. Aber stellen Sie sich das Gegenteil vor. Was wäre passiert, hätte die Schweinegrippe die Hälfte der Infizierten getötet und es hätte keinen Impfstoff gegeben?“ Mit der ausweichende Antwort will die WHO offenbar ihre Entscheidungen mit dem Vorsorgeprinzip rechtfertigen, ohne dabei auf die starken finanziellen Interessenverquickungen einzugehen.
Brisant: die WHO-Arbeitsgruppe zur Schweinegrippe bestand aus 13 externen Beratern, von denen einige enge Verbindungen zur Pharmaindustrie hatten. Der Epidemiologe Neil Ferguson mit seinen panikauslösenden Modellrechnungen deklariert Beratungshonorare von GlaxoSmithKline, Baxter und Roche – genau jenen Unternehmen, die Schweinegrippe-Impfstoffe und -Medikamente herstellten. Auch Albert Osterhaus, ein weiterer WHO-Berater, gab an, Anteile an Pharmaunternehmen zu besitzen. „Ich versichere Ihnen, heutzutage gibt es keine einzige wissenschaftliche Konferenz mehr, die nicht von der Industrie bezuschusst wird. Und das zu Recht!“, verteidigt Osterhaus diese Verflechtungen.
Während sich die WHO öffentlich für Transparenz aussprach, gab es innerhalb der Organisation offenbar wenig offene Kommunikation. German Velasquez, ein ehemaliger Leiter der WHO-Abteilung für öffentliche Gesundheit, berichtet: „Beim Ausbruch der Schweinegrippe war ich bei der WHO Leiter der Abteilung für öffentliche Gesundheit, Patente und Medikamente. Hier hatte keiner Angst. Ich kannte niemanden in der WHO, der sich dagegen geimpft hat.“ Besonders schockierend: Velasquez wurde aus einem wichtigen WHO-Treffen ausgeschlossen, als es um die Zusammenarbeit mit Impfstoffherstellern ging. „Ich ging runter zum Vorstandsraum. Die Person an der Tür sagte: ‚Nein, das ist ein privates Treffen.‘ Ich, als leitender WHO-Angestellter, der für ein wichtiges Thema verantwortlich war, welches dort besprochen wurde, durfte nicht eintreten.“
Der Europarat kritisierte später die Intransparenz der WHO scharf und forderte Änderungen. Dr. Wolfgang Wodarg bemerkt dazu: „Die Beamten der WHO haben davon ja keine Ahnung. Die sind angewiesen auf Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler werden ihnen entsandt von den Ländern und von den Geldgebern der WHO. Und da saßen eben sehr viele, die im Interesse der Pharmaindustrie beraten und entschieden haben.“ Die WHO selbst zeigte sich jedoch wenig kooperativ: „Die WHO hat dann nicht mehr auf den Europarat reagiert. Schon bei der zweiten Anhörung ist sie nicht mehr gekommen. Sie müssen ja nicht. Sie sind uns keinerlei Auskunft schuldig.“
Abschließend warnt Wodarg vor einer zunehmenden Privatisierung des öffentlichen Gesundheitswesens: „Wir haben eine Zeit der Deregulierung, fast der Auflösung staatlicher Aufgaben, der Privatisierung staatlicher Aufgaben. Und da gibt es eine ganz massive Lobbyarbeit, neue Wachstumsfelder da zu schaffen, wo vorher öffentliche Verantwortung war.“
Ein konkretes Beispiel für die Verflechtung von Politik und Wirtschaft ist auch der Besuch von Nicolas Sarkozy bei Sanofi in Mexiko kurz vor Beginn der Schweinegrippe: „Am 9. März 2009 war Sarkozy dort und hat 100 Millionen Euro für ein Impfstoffwerk investiert.“
4. Dr. Wolfgang Wodargs Erfahrungen im Bundestag und Europarat
Wodarg versuchte 2009, im Bundestag auf die Missstände hinzuweisen. Doch die politische Lage war schwierig: „2009 war das Jahr der Bundestagswahl.“ Viele Abgeordnete seien mehr mit ihrer Wiederwahl als mit inhaltlicher Arbeit beschäftigt gewesen. In der SPD-Fraktion habe Ulla Schmidt als Gesundheitsministerin gesagt: „Ihr könnt in den Wahlkampf ziehen […] wir haben Impfstoff für alle besorgt.“
Sein Versuch, Kritik zu äußern, wurde kaum aufgenommen. Erst ein Artikel im Flensburger Tageblatt, der später in der BILD-Zeitung zitiert wurde, verschaffte ihm mediale Aufmerksamkeit. Darin warnt er vor Risiken neuartiger Impfstoffe, insbesondere solchen, die in Bioreaktoren mit Tierzellen hergestellt wurden.
Entscheidenden Einfluss konnte Wodarg dann im Europarat gewinnen. Als Vorsitzender des Unterausschusses für Gesundheit initiierte er eine Untersuchung zur Schweinegrippe. Der Antrag wurde zügig aufgenommen: „Das wurde sofort erkannt […] das ist eigentlich das demokratischste Gremium, das wir haben.“
Die Anhörungen führten zu einem offiziellen Bericht, der gravierende Versäumnisse benannte: Änderung der Pandemie-Definition, Intransparenz der WHO, Interessenverflechtung mit der Pharmaindustrie. Der Bericht war international wirksam, etwa in Japan, wo die Empörung der Bevölkerung wegen Großankäufen nutzloser Impfstoffe durch die Politik groß war.
Wodarg nutzte seine Rolle, um internationale Aufmerksamkeit auf die Vorgänge zu lenken. Das Ziel war klar: Aufklärung, Transparenz und die Wiederherstellung einer wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik. „Die WHO wurde gebrandmarkt, und es wurde angemahnt, dass sie transparenter wird.“
5. Fehlentwicklungen in Wissenschaft und Politik
Die Sitzung beleuchtet auch strukturelle Probleme im Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Industrie. Wodarg kritisiert, dass sich Wissenschaft zunehmend zum Erfüllungsgehilfen politischer oder wirtschaftlicher Ziele entwickle. Statt unabhängiger Forschung dominiere ein System projektbezogener Drittmittelfinanzierung, das bestimmte Narrative bevorzuge.
Er warnt vor der zunehmenden Verflechtung staatlicher Institutionen mit privaten Konzernen: „Früher wurden Impfstoffe von staatlichen Instituten hergestellt, heute verdient man damit Geld.“ Auch die WHO sei inzwischen zu 80% durch zweckgebundene Mittel finanziert, etwa von der Gates-Stiftung oder bestimmten Staaten.
Die politische Reaktion blieb laut Wodarg unzureichend. „In Deutschland, Stillschweigen. Keine Aufarbeitung. Keine Anhörung.“ Erst im Europarat wurde die Thematik öffentlich verhandelt. Wodarg plädiert für eine Rückkehr zu Transparenz, Rechenschaftspflicht und wissenschaftlicher Integrität in der Gesundheitspolitik.
6. Kritik an der Impfstoffentwicklung und -verteilung
Dr. Wodarg äußert deutliche Bedenken gegenüber der Art und Weise, wie Impfstoffe während der Schweinegrippe entwickelt und verbreitet wurden. Besonders kritisch sieht er die Nutzung neuer Technologien wie die Herstellung von Impfstoffen in Bioreaktoren auf Basis tierischer Zellen. Der Impfstoff von Novartis sei etwa mit Nierenzellen eines Hundes produziert worden, was laut Wodarg problematisch sei: „Das sind Zellen, die sich sehr schnell vermehren wie Krebszellen.“
Diese Technologie wurde ohne ausreichende Langzeitstudien eingesetzt. Wodarg betont, dass eine verlässliche Prüfung auf mögliche krebserregende Effekte nur durch mehrjährige Nachbeobachtung erfolgen könne. „Wenn man ausschließen will, dass so ein Impfstoff Krebs auslöst, dann muss man ihn mindestens fünf Jahre nachbeobachten.“ Bei der damaligen Zulassung sei dies jedoch nicht geschehen.
Ein weiteres Problem stellt die Verwendung von Wirkverstärkern (Adjuvantien) dar, mit denen etwa GlaxoSmithKline seine Impfstoffe versetzte, um mit geringerem Antigenverbrauch mehr Impfdosen zu produzieren. Diese Wirkverstärker können das Immunsystem stark aktivieren – mit dem Risiko schwerer Nebenwirkungen. In mehreren Ländern, darunter Irland und Schweden, kam es zu Fällen von Narkolepsie bei Kindern. Wodarg schildert: „Das ist wie ein Krampfanfall, bei dem man einschläft. […] Die sind schwerstbehindert.“ Prozesse gegen Hersteller liefen u.a. in Irland.
Ein weiterer Aspekt betrifft die mangelnde Nachfrage. Trotz beschaffter Millionen Dosen ließen sich in Deutschland nur wenige Menschen impfen. Viele Ärzte verweigerten die Verabreichung – nicht pauschal gegen Grippeimpfstoffe, sondern gezielt gegen diese neuartigen Produkte. „Viele Ärzte haben gesagt, ich mache das nicht.“ Die übrigen Impfstoffe wurden später vernichtet. Die Öffentlichkeit trug letztlich die Kosten für Entwicklung, Beschaffung und Entsorgung.
7. Gefahren und Nebenwirkungen der Impfstoffe
Wodarg schildert ausführlich die strukturellen Probleme bei der Risikoabschätzung und Nebenwirkungsbewertung. Besonders kritisiert er das Paul-Ehrlich-Institut, das seiner Ansicht nach nicht transparent genug mit Nebenwirkungsmeldungen umging. In Schweden seien bei gleicher Impfquote doppelt so viele Nebenwirkungen gemeldet worden wie in Deutschland – nicht wegen biologischer Unterschiede, sondern wegen besserer Dokumentation: „Das kann nicht sein, dass die Deutschen da tougher sind.“
Die Nebenwirkungen reichten von leichten Beschwerden bis zu schweren neurologischen Komplikationen wie der erwähnten Narkolepsie. In mehreren Ländern laufen noch Jahre später Gerichtsverfahren. Die Betroffenen seien oft Kinder, deren Leben dauerhaft beeinträchtigt sei. Besonders erschütternd sei, dass viele Eltern und Ärzte im Vertrauen auf staatliche Empfehlungen handelten.
Auch die Haftungsfrage wird thematisiert. Impfstoffhersteller würden durch staatliche Abnahmegarantien und Haftungsausschlüsse geschützt, während die Allgemeinheit die Kosten und die Risiken trage. Wodarg erläutert, dass in Deutschland bei staatlich empfohlenen Impfungen das Versorgungsamt für mögliche Impfschäden zuständig sei – der Prozess zur Anerkennung jedoch langwierig und belastend. In anderen Ländern, etwa Schweden, sei der Umgang großzügiger und transparenter.
Er beschreibt auch, wie politische Dynamiken eine offene Debatte erschwerten. Selbst innerhalb der Ärzteschaft herrschte Zurückhaltung, viele Diskussionen fanden nur intern statt. Das offizielle Narrativ blieb unangetastet. In Frankreich hingegen habe der Senat öffentliche Anhörungen abgehalten. In Deutschland blieb eine umfassende Aufarbeitung aus: „Keine Anhörung. Das war überhaupt kein Thema.“
8. Zweifel an der Pandemie-Definition und Medienberichterstattung
Ein zentrales Thema bleibt die Veränderung der Pandemiedefinition durch die WHO. Vor 2009 enthielt diese noch die Kriterien einer hohen Erkrankungsschwere und Sterblichkeit – beides wurde gestrichen. Wodarg betont: „Nachdem das weggelassen wurde aus der Definition, diese Kriterien, ist jede Grippewelle eine Pandemie.“
Diese Definitionsänderung wurde weder breit kommuniziert noch wissenschaftlich begründet. Wodarg verweist auf eine Pressekonferenz der WHO, in der ein Sprecher lediglich sagte: „Wir werden das nochmal diskutieren.“ Für viele Mitgliedstaaten war das inakzeptabel. In einem Bericht vom 19. Mai 2009 heißt es: „Nations urge WHO to change criteria for pandemic.“ Doch die Änderung blieb bestehen.
Medien spielten laut Wodarg eine zentrale Rolle in der Eskalation. Durch selektive Berichterstattung, dramatische Bilder und die ungeprüfte Weitergabe von Szenarien wurde eine kollektive Angst erzeugt. Die sogenannte „Schweinegrippe-Pandemie“ wurde damit aus einer vergleichsweise milden Grippewelle zu einem weltweiten Notfall stilisiert.
Wodarg prangert auch die Rolle von Experten an, deren Unabhängigkeit fragwürdig war. Einige von ihnen, die an zentralen Entscheidungen mitwirkten, wechselten kurz danach in die Pharmaindustrie. Dies sei im Bericht des Europarates dokumentiert. Die Grenzen zwischen Wissenschaft, Beratung und Lobbyismus seien zunehmend verwischt.
Diese Erkenntnisse werfen grundsätzliche Fragen auf: Was ist eine Pandemie? Wer entscheidet das? Und auf welcher Grundlage? Die Diskussion um die Definition ist laut Wodarg nicht nur semantisch, sondern politisch hochbrisant. Denn mit ihr stehen Milliardenverträge und politische Maßnahmen auf dem Spiel.
9. PCR-Test als politisches Steuerungsinstrument
Dr. Wolfgang Wodarg betont, dass während der Corona-Pandemie erneut auf Basis unklarer oder sich wandelnder Definitionen weitreichende Maßnahmen gerechtfertigt wurden. Besonders kritisch äußert er sich zur Rolle des PCR-Tests. Dieser sei zum zentralen Steuerungsinstrument geworden, obwohl er ursprünglich gar nicht zur Diagnostik im klinischen Sinne entwickelt worden war:
„Wir haben gelernt, dass ein Test allein keine Diagnose ist. Und wenn man damit Politik macht, dann muss man sich über die Folgen im Klaren sein.“
Wodarg kritisiert, dass durch die massenhafte Anwendung des PCR-Tests, insbesondere ohne standardisierte Ct-Wert-Grenzen, eine große Zahl von „Fällen“ erzeugt wurde, die keine Aussage über tatsächliche Erkrankung oder Ansteckungsgefahr zuließen. Diese positiv Getesteten seien politisch wie klinisch häufig unzutreffend als „Infizierte“ bezeichnet worden, was die öffentliche Wahrnehmung massiv beeinflusste.
Er weist darauf hin, dass dieses Testregime eine neue Realität geschaffen habe, die nicht dem klassischen Verständnis von Infektionskrankheiten folgte, sondern ein „Labor-Ereignis“ in einen gesellschaftlichen Ausnahmezustand übersetzte.
10. Die Rolle des IQWIG in der Pandemie
Ein Aspekt, der in der Sitzung besondere Aufmerksamkeit findet, ist die weitgehend stille Rolle des IQWIG, des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, während der Corona-Pandemie. Wodarg kritisiert, dass dieses zentrale Institut, das eigentlich mit der Auswertung medizinischer Versorgungsdaten und Qualitätssicherung betraut ist, kaum öffentlich in Erscheinung trat. Gerade bei entscheidenden Fragen – etwa zur tatsächlichen Auslastung der Krankenhäuser, zur Wirksamkeit von Behandlungsmaßnahmen oder zu den Auswirkungen der Teststrategien – hätte das IQWIG eine wichtige Funktion als Kontrollinstanz einnehmen können.
„Wo war das IQWIG, als die Krankenhäuser mit Testregimen und Auslastungsdaten operiert haben?“ fragt Wodarg provokant.
Er sieht darin ein strukturelles Defizit: Obwohl das IQWIG über den Zugang zu umfangreichen Abrechnungs- und Leistungsdaten verfügt, sei keine unabhängige und transparente Analyse der Pandemiepolitik bekannt geworden. Dies sei besonders problematisch, da viele Maßnahmen – wie etwa Krankenhauszuschläge für „freigehaltene Betten“ – auf Daten basierten, deren Erhebung und Interpretation weitgehend im Verwaltungsdunkel stattfand.
Wodarg fordert, dass Institutionen wie das IQWIG künftig stärker in die öffentliche Bewertung gesundheitspolitischer Entscheidungen eingebunden werden. Nur so könne vermieden werden, dass politische Maßnahmen auf unzureichend geprüften Zahlen beruhen. Das Versäumnis, vorhandene Strukturen zur unabhängigen Qualitätssicherung aktiv zu nutzen, sei eine vertane Chance – mit schwerwiegenden gesellschaftlichen Folgen.
11. Vergleiche mit der Corona-Krise
Die Parallelen zwischen der Schweinegrippe 2009 und der Corona-Pandemie 2020ff. bilden einen zentralen Punkt in Wodargs Analyse. Er sieht viele der Mechanismen aus dem Jahr 2009 während der COVID-19-Krise erneut am Werk. Er habe Zuschriften bekommen, warum er sich im Rahmen von Corona nicht erneut kritisch geäußert habe, er sagt: “Ich habe das ja gemacht bei Corona, nur da ist man mir nicht gefolgt.“ Nach ersten Interviews in Main-Stream-Medien habe man sich bemüht, seine kritische Stimme medial unsichtbar zu machen. Ein echter Medien-Blackout.
Wodarg betont, dass nun wieder auf Basis unklarer oder sich wandelnder Definitionen weitreichende Maßnahmen gerechtfertigt wurden. Die intensive Teststrategie mit PCR-Tests sei symptomatisch: „Wenn Sie bei uns in die Gesellschaft eine Information reinbringen, dann verändert das manchmal die Gesellschaft nachhaltig.“ Auch die Rolle von Neil Ferguson ist wieder zentral. Dessen Prognosen führten weltweit zu Lockdowns, obwohl sich seine Vorhersagen schon bereits zuvor in allen sogenannten Pandemien als stark überzogen herausgestellt hatten.
Zudem werden auch bei Corona Impfstoffe in Eilverfahren zugelassen. Dies geschieht auf Basis temporärer Notfallzulassungen, ohne die üblichen langen Beobachtungszeiträume. Wodarg weist erneut auf das Problem fehlender Krebsstudien und autoimmunologischer Reaktionen hin. Die Wiederholung alter Muster ist aus seiner Sicht ein Alarmzeichen: „Die Dynamik ist dieselbe. Nur diesmal in noch größerem Maßstab.“
Auch wirtschaftliche Aspekte gleichen sich. Wieder profitieren große Pharmafirmen von milliardenschweren Staatsaufträgen, wieder erfolgt eine staatliche Haftungsübernahme, und wieder bleibt eine transparente Aufarbeitung aus. Die Strukturen internationaler Abhängigkeiten, insbesondere zur WHO, seien nicht verbessert worden. Vielmehr habe sich deren Einfluss sogar verstärkt.
Wodarg sieht in den Ereignissen rund um Corona eine Fortschreibung der Fehlentwicklungen seit 2009. Die Institutionen hätten aus der damaligen Kritik nichts gelernt. Schlimmer noch: „Der Staat hat sich da entsorgt.“ Der Aufschrei sei diesmal noch leiser – eben auch weil Kritik schnell als unsolidarisch oder verschwörungsideologisch diskreditiert werde.
12. Forderungen nach Aufklärung und Reform
Im Verlauf der Sitzung wird deutlich, dass es Wodarg und dem Ausschuss nicht allein um Vergangenheitsbewältigung geht. Vielmehr geht es um die Forderung nach systematischer Aufarbeitung, Reformen und einer Rückkehr zu transparenter, wissenschaftsbasierter Politik. Wodarg betont: „Das ist das Tolle am Europarat, dass man da alles zur Sprache bringen kann.“
Eine zentrale Forderung ist die Reform der WHO. Diese müsse unabhängiger von privaten Geldgebern agieren. Derzeit werde sie zu 80% über zweckgebundene Mittel finanziert, was eine sachliche, neutrale Bewertung erschwere. Die größten Geldgeber seien nicht Staaten, sondern private Stiftungen und Konzerne: „Da wird über Bande gespielt.“
Transparente Entscheidungsprozesse, die Offenlegung von Interessenkonflikten sowie eine Trennung von Forschung und Industrieinteressen stehen im Zentrum der Reformvorschläge. Die Pandemiepläne müssten sich wieder an objektiven Kriterien orientieren – dazu gehöre auch die Rückkehr zu einer differenzierten Pandemiedefinition, die die Schwere der Erkrankung berücksichtigt.
Zudem müssten Zulassungsverfahren für Impfstoffe reformiert werden. Verkürzte Verfahren dürften nicht zur Norm werden. Die Nachverfolgung von Nebenwirkungen müsse erleichtert, die Entschädigung Betroffener entbürokratisiert werden. Auch die Rolle von Medien und Wissenschaftskommunikation solle überprüft werden – insbesondere, wie mit abweichenden Meinungen umgegangen wird.
Fischer und Fuellmich unterstützen die Forderungen und sehen in der Ausschussarbeit einen Beitrag zur gesellschaftlichen Aufklärung. Dr. Justus Hoffmann ergänzt, dass es auch juristische Konsequenzen geben müsse: „Wenn das wiederholt möglich ist, dann ist das ein strukturelles Problem.“
13. Fazit
Die erste Sitzung des Corona-Ausschusses liefert einen tiefgehenden historischen, medizinischen und politischen Überblick über die Schweinegrippe 2009 – mit klarem Bezug zur Corona-Krise. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Rolle der WHO, der Einflussnahme durch wirtschaftliche Interessen sowie die strukturelle Schwäche demokratischer und wissenschaftlicher Kontrollmechanismen.
Wodarg zeigt in seinem detaillierten Bericht, wie systematisch und wiederholt dieselben Muster auftauchen: Definitionen werden angepasst, Szenarien überdramatisiert, Verträge intransparent gehalten und Kritik marginalisiert. Der Nutzen für bestimmte Akteure ist groß, die Risiken für die Allgemeinheit ebenso. Wodarg bringt es auf den Punkt: „Die Pandemie war ein Fake.“
Die Sitzung endet mit dem Appell an Öffentlichkeit und Politik, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Der Ausschuss will dazu beitragen, dass zukünftige gesundheitliche Krisen faktenbasiert, transparent und demokratisch bewältigt werden. Dabei steht die Integrität wissenschaftlicher Institutionen ebenso auf dem Prüfstand wie die Verantwortung politischer Entscheidungsträger.
Die Arbeit des Corona-Ausschusses versteht sich somit als Mahnung und Chance zugleich – ein Ruf nach Verantwortung, Aufklärung und echter Gesundheitspolitik im Dienste der Menschen. Die Vergangenheit liefert die Indizien, die Gegenwart stellt die Fragen – und die Zukunft verlangt nach Antworten.
Auf die Frage, warum die WHO die Welt ohne ersichtlichen Grund in Panik versetzte, gab es von offizieller Seite kaum klare Antworten. Als Lilian Franck den WHO-Sprecher direkt mit den Geheimverträgen zwischen Pharmaunternehmen und Regierungen konfrontiert, entgegnet dieser: „Natürlich muss man darüber, sowie über alles andere Bescheid wissen. Hinterher ist es leicht zu sagen, derjenige hätte dies nicht machen sollen und ein anderer hätte jenes nicht machen sollen. Aber stellen Sie sich das Gegenteil vor. Was wäre passiert, hätte die Schweinegrippe die Hälfte der Infizierten getötet und es hätte keinen Impfstoff gegeben?“ Mit der ausweichende Antwort will die WHO ihre Entscheidungen mit dem Vorsorgeprinzip rechtfertigen, ohne dabei auf die starken finanziellen Interessenverquickungen einzugehen.
Der Europarat kritisierte später die Intransparenz der WHO scharf und forderte Änderungen. Dr. Wolfgang Wodarg bemerkt dazu: „Die Beamten der WHO haben davon ja keine Ahnung. Die sind angewiesen auf Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler werden ihnen entsandt von den Ländern und von den Geldgebern der WHO. Und da saßen eben sehr viele, die im Interesse der Pharmaindustrie beraten und entschieden haben.“ Die WHO selbst zeigte sich jedoch wenig kooperativ: „Die WHO hat dann nicht mehr auf den Europarat reagiert. Schon bei der zweiten Anhörung ist sie nicht mehr gekommen. Sie müssen ja nicht. Sie sind uns keinerlei Auskunft schuldig.“
Abschließend warnt Wodarg vor einer zunehmenden Privatisierung des öffentlichen Gesundheitswesens: „Wir haben eine Zeit der Deregulierung, fast der Auflösung staatlicher Aufgaben, der Privatisierung staatlicher Aufgaben. Und da gibt es eine ganz massive Lobbyarbeit, neue Wachstumsfelder da zu schaffen, wo vorher öffentliche Verantwortung war.“ Die Dokumentation macht deutlich, dass die Schweinegrippe nicht nur ein medizinisches, sondern vor allem ein wirtschaftliches und politisches Ereignis war, das grundsätzliche Fragen über Transparenz und Interessenskonflikte in internationalen Gesundheitsorganisationen aufwirft.